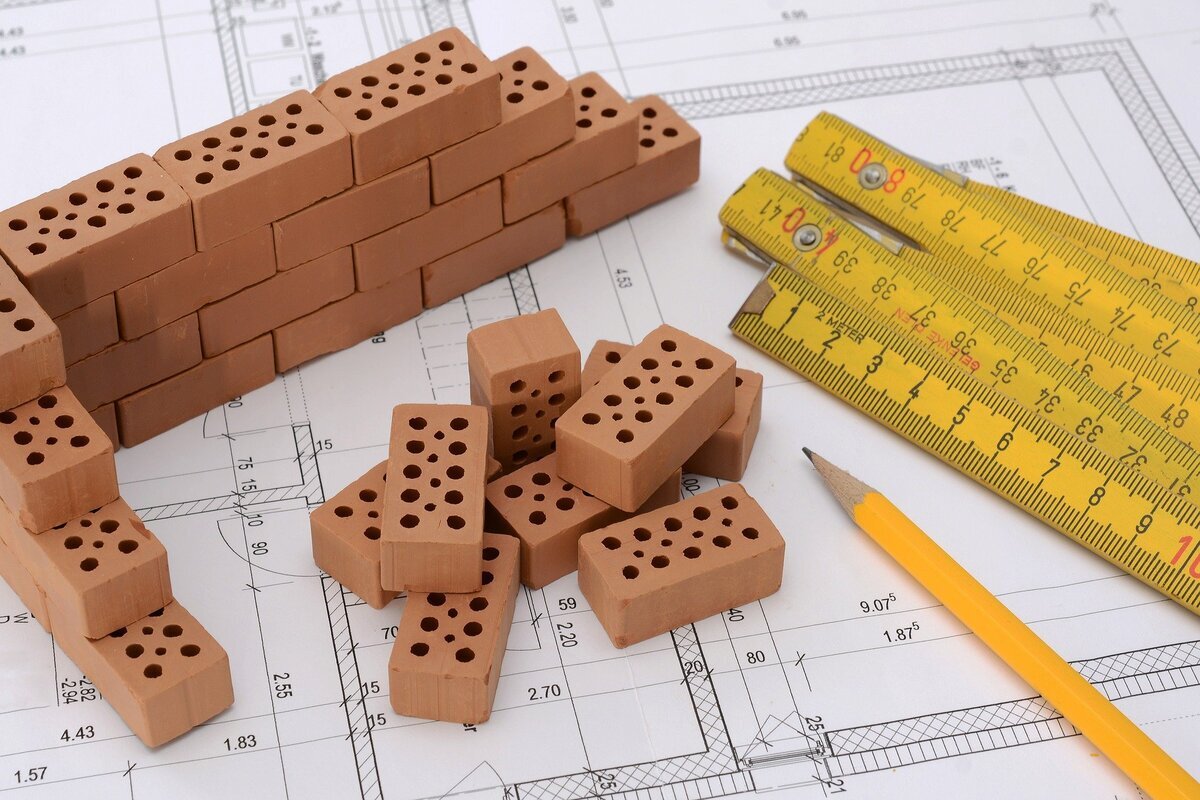- Immobilien
- Autos
- Stellen
- Singles
- Reisen
- Finanzen

Was man über Nießbrauchrecht wissen muss
Diese Dinge sollten Immobilieneigentümer und solche, die es werden möchten, über Nießbrauch wissen.
Wer sich durch einen Hauskauf oder gar durch eine Schenkung mit dem Thema Immobilienrecht beschäftigt, kommt um den Begriff Nießbrauchrecht kaum herum. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen von „usus fructus“ (Recht auf Fruchtziehung) ab und wird im allgemeinen Sprachgebrauch nicht häufig verwendet. Dennoch ist das Nießbrauchrecht für Personen mit Wohneigentum ein nicht ganz uninteressantes Thema. Diese Dinge sollte man über das Nießbrauchrecht wissen:
Was genau hat man unter dem Nießbrauchrecht zu verstehen?
Der Nießbrauch an einem Gegenstand – meist einer Immobilie – ist im §1030 BGB definiert. Im Bezug auf Immobilien handelt es sich dabei um ein stark erweitertes Wohn- und Nutzungsrecht, das in der Regel auf Lebenszeit ausgesprochen wird. Der Nießbrauch wird notariell im Grundbuch vermerkt, sodass es durch Eigentümer und Nießbraucher nicht willkürlich beendet werden kann.
Das Nießbrauchrecht kann Senioren sogar zu einem Darlehen im Rentenalter verhelfen – etwas, das im Alter durch Banken kaum mehr darstellbar ist: Im Rahmen einer Umkehrhypothek kann man beispielsweise eine Grundschuld auf eigene Wohnimmobilien aufnehmen und dadurch einen Kredit erhalten, ohne die Immobilie verkaufen oder verlassen zu müssen. Der Nießbrauch erlaubt es einem, in der Immobilie zu bleiben und umfangreiche Rechte zu genießen.
Unterschiedliche Arten von Nießbrauch
Beim Nießbrauch unterscheidet man zwischen vier Arten, die steuer- und erbrechtlich etwas unterschiedlich zu beurteilen sind:
Der entgeltliche Zuwendungsnießbrauch sieht Zahlungen des Nießbrauchnehmers an die Eigentümer vor. Diese Zahlungen können als Werbungskosten geltend gemacht werden. Seitens der Eigentümer müssen die Mieteinnahmen zwar versteuert werden, dafür dürfen Abschreibungen für die Wohnimmobilie geltend gemacht werden. Zuwendungsnießbrauch kann auch teilentgeltlich oder unentgeltlich sein.
Ein Vorbehaltsnießbrauch liegt vor, wenn jemand seine Immobilie auf eine andere Person überträgt, sich aber ein Wohn- und Nutzungsrecht einräumen möchte. Beim nachrangigen Nießbrauchrecht kann der Nießbrauchnehmer bei Vertragsabschluss einen Nachfolger benennen – weil Nießbrauchrecht nicht übertragen oder vererbt werden kann, ist dies die einzige Möglichkeit, die Nachfolge zu regeln. Quotennießbrauch liegt dann vor, wenn Eigentümer und Nießbrauchnehmer sich Einkünfte aus Vermietung oder Verpachtung teilen.
Vorteile für den Nießbraucher
Wer ein Nießbrauchrecht genießt, kann in einer Immobilie leben, die rechtlich gesehen nicht zum Eigentum zählt, und dennoch weitgehend frei darüber verfügen. Besonders dann, wenn ältere Menschen ihr Wohneigentum zu Lebzeiten auch ihre Nachkommen überschreiben oder wenn Personen sich durch eine Immobilienverrentung zusätzliche Einnahmen im Alter sichern möchten, ohne umziehen zu müssen, birgt der Nießbrauch also viele Vorteile.
Wofür braucht man Nießbrauch?
Nießbrauch benötigt man immer dann, wenn man eine Immobilie nicht sein Eigentum nennt, diese aber bewohnen, nutzen oder vermieten möchte. Selbstverständlich kann man dies theoretisch auch ohne Eintragung ins Grundbuch tun, wenn man sich beispielsweise mit der Person versteht, auf die das Eigentum übertragen wurde. Dennoch sollte man rechtlich immer auf Nummer Sicher gehen und das Nießbrauchrecht nicht nur notariell festhalten, sondern auch im Grundbuch verankern lassen.
Rechte und Pflichten eines Nießbrauchers
Der Nießbrauchnehmer darf in einer definierten Wohneinheit leben und diese so nutzen, wie er möchte. Die einzigen Ausnahmen stellen dabei der Verkauf der Immobilie sowie die mutwillige Zerstörung derselben dar. Anfangs wurde die Herkunft des Wortes Nießbrauch auf den lateinischen Begriff „usus fructus“ – Fruchtziehen – zurückgeführt. Das bedeutet, der Nießbrauchnehmer darf sogar Einkünfte aus der Immobilie, beispielsweise aus deren Vermietung ziehen. Nießbrauch gilt in der Regel auf Lebenszeit. Wenn es vertraglich festgehalten wurde, ist dem Eigentümer ein Entgelt für die Nutzung zu bezahlen.
Rechte des Eigentümers
Der Eigentümer kann die Wohneinheit verkaufen, die durch das Nießbrauchrecht betroffen ist, das Nießbrauchrecht bleibt aber auch beim Verkauf Bestandteil des Grundbuches. Während Eigentümer kleinere Reparaturen zur Instandhaltung vom Nießbrauchnehmer abwickeln lassen können, sind größere Modernisierungen vom Eigentümer selbst zu tragen.
Wo liegt der Unterschied zum Wohnrecht und was sind die Gemeinsamkeiten?
Sowohl beim Wohn- und Nutzungsrecht als auch beim Nießbrauchrecht steht es anderen Personen als den Eigentümern frei, weitgehend selbstständig über eine Immobilie zu verfügen. Der größte Unterschied zwischen beiden Modellen des Nutzungsrechtes an einer Immobilie, ist der Nießbrauch selbst – also die Möglichkeit, fruchtbringend über die Immobilie zu verfügen. Wer ein reines Wohnrecht genießt, darf die betreffende Immobilie nicht vermieten – diese Option bietet nur der Nießbrauch.